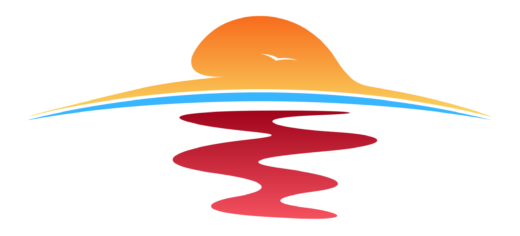Menschenfeindlich ist nicht der richtige Ausdruck für diese steinerne Einöde am vermeintlichen Ende der Welt. Der Homo sapiens, dieses verletzliche Wesen aus Haut und Knochen gehört hier nicht hin, erscheint schlicht und einfach deplatziert. Hier herrscht mit stiller, unumschränkter Macht die Natur. Regenschauer fegen erbarmungslos über den unheilvoll aufragenden nackten Fels; Sekunden später mutiert er zu einem alles Nieselschleier, mit dem pfeifenden Wind als Begleitmusik. Kurz darauf schieben sich goldene Sonnenstrahlen durch die stockdunkle Wolkendecke, verwandeln die eben noch trübe Fahrrinne in ein funkelndes Band aus flüssigem Silber. Sie geben den Blick frei auf frisch verzuckerte Bergspitzen. Hier unten, im wilden Süden Chiles, sind die Sommer kurz und das Wetter genauso schroff und unstetig wir die Natur.

Inhaltsverzeichnis
Leere als Leinwand
Kaum vorstellbar, wie sich die Segelschiffe vergangener Tage in diesem Labyrinth aus verwinkelten Kanälen und öden Inseln zurechtgefunden haben. In diesem Wirrwarr aus windgepeitschten Wasserarmen, gefährlich kalbenden Gletschern und schneebedeckten Berggipfeln stießen selbst erfahrene Seebären in schaukelnden Nussschalen an ihre Grenzen. Denn manche Rinne Richtung Ozean entpuppte sich als Sackgasse. Magellan, getrieben von der Suche nach dem kürzesten Weg zu den Gewinn versprechenden Gewürzinseln, hatte Glück und fand die nach ihm benannte Wasserstraße. Andere waren weniger erfolgreich, kreuzten erfolglos gegen den unablässig blasenden Wind, wurden Opfer einer der unzähligen Untiefen an diesem magischen Ort, dessen kaum zu beschreibende Leere für viele Reisende zur Leinwand ihrer eigenen Entwürfe wurde.

Der wilde Süden – das Ende der Welt
Die spanischen Eroberer hatten diese Ecke der Weltkugel reichlich ernüchtert als „fin del mundo“, als Ende der Welt tituliert. Und auch Charles Darwin, der vor 180 Jahren an Bord der „Beagle“ nicht nur Galapagos besuchte, sondern auch durch die wilden Gewässer an Amerikas Südspitze segelte, war zunächst keineswegs beeindruckt von diesem Landstrich, der außerhalb unserer Zeit zu liegen scheint. Erst im Nachhinein erschlossen sich ihm die Wunder Patagonien, fand der karge Landstrich einen festen Platz in seinem Gedächtnis. „
Ich kann diese Empfindungen kaum analysieren, sie müssen aber die Folge davon sein, dass hier der Einbildung volle Freiheit gegeben ist.
bekannte der berühmte Forscher. Heute ist zwar jede Falte dieses mythenumwobenen Landstriches erforscht, jeder Berg bestiegen, jeder Gletscher benannt; und doch bleibt Chiles wilder Süden geheimnisvoll, wirklich und unwirklich zugleich; ein Treibhaus für Forscherdrang, Pioniergeist und Abenteuerlust.

Kreuzen vor der “Allee der Gletscher”
So sagenhaft regnerisch es zwischen Magellanstraße und Beaglekanal auch zugehen mag: Auf der „Allee der Gletscher“ vor der zu Chile und Argentinien gehörenden Insel Feuerland hält es niemanden in der Koje. Zum Staunen muss man an Deck, hinaus in dieses Universum aus Nieselregen, peitschendem Wind und tiefhängenden Wolken. An einigen Stellen sind die Passagen so eng, dass windzerzauste „Eroberer“ nicht einmal ein Fernglas brauchen, um die patagonische Flora und Fauna auszukundschaften. An geschützten Stellen saugen Flechten und Moose gierig das Leben spendende Nass auf. Darüber glänzen schneebedeckte Kuppen in jungfräulichem Weiß. Seevögel vollführen akrobatische Flüge, und mit viel Glück lassen sich schwergewichtige Seelöwen ausmachen, die sich träge auf Eisschollen wälzen. Für Nachschub sorgen die unzähligen Gletscher, die der Meerenge ihren Namen gegeben haben und sich wie eisblaue Stoffbahnen von den Bergen hinabwälzen. Europäische Auswanderer benannten die scheinbar unverwüstlichen Eisriesen nach ihrer alten Heimat, bevor sie sich in weniger unwirtlichen Gegenden des riesigen Landes niederließen.

In Punta Arenas
Einer der Namensgeber war Commodore John Byron, Großvater des Dichters Lord Byron. Punta Arenas, sandiger Punkt, taufte er jenen Flecken auf der Brunswick-Halbinsel, der sich reichlich großspurig als südlichste Stadt verkauft. Damit steht das Aussteiger-Paradies in Chiles wildem Süden allerdings nicht alleine: Sowohl der Nachbar Puerto Williams als auch das argentinische Ushuaia schmücken sich gerne mit dem werbewirksamen Slogan.
Doch was habe die Konkurrenz schon in die Waagschale zu werfen, tut Reiseführerin Sara alle Einwände ab. Ushuaia liegt zwar südlicher, sei aber nur eine wild wuchernde, ehemalige Sträflingskolonie. Und Puerto Williams mit seinen knapp 3 000 Einwohnern könne man ja kaum als Stadt bezeichnen. Allenfalls könne man den chilenischen Marinestützpunkt am Beagle Kanal als südlichste Siedlung der Welt durchgehen lassen, gesteht Reiseführerin Sara dem Konkurrenten aus dem eigenen Land zu.

Das Tor zum wilden Süden
Dabei blickt Punta Arenas – Tor zu Patagonien, Feuerland und zur Antarktis – ebenfalls auf eine reichlich unrühmliche Vergangenheit als Strafgefangenenkolonie zurück. Erst 1876 erteilte die chilenische Regierung Einwanderern die Erlaubnis zur Schafzucht in der menschenleeren Weite der Südspitze des Landes. Die wirkt mit ihren Hunderten vorgelagerten Inselchen wie der zerborstene Schweif eines Kometen.
Für Yamana, Selk‘nam und die anderen Stämme, die Jahrtausende lang mit einfachen Harpunen Jagd auf Fische und Robben gemacht hatten, kam die Landnahme durch die Weißen einem Todesurteil gleich: Eingeschleppte Krankheiten rafften die Jäger und ihre Familien dahin; Todeskommandos machten Jagd auf die „unzivilisierten Wilden“ oder verschleppten die Menschen als lebende Ausstellungsstücke nach Europa. Punta Arenas dagegen wuchs und wuchs, begünstigt durch seine Lage an der Magellanstraße. Sie ersparte Schiffen den brandgefährlichen Weg um das von Wind und Wellen gepeitschte Kap Hoorn.

Der wichtigste Hafen im Süden
Magellan bekam immerhin ein Bronzedenkmal spendiert. Auf dem zentralen Platz der 120 000 Einwohner zählenden Stadt, der Plaza de Armas, steht er überlebensgroß in heroischer Positur: der Portugiese in spanischen Diensten, der 1520 durch Zufall den fast 600 Kilometer langen Seeweg am Rande des amerikanischen Kontinents entdeckt hatte. Dass der Kapitän einem ziemlichen Irrtum aufsaß – sein „Mare Pacífico“ ist nämlich alles andere als ein Stiller Ozean -, sei ihm verziehen. Zumal seine abenteuerliche Odyssee den Nachweis erbrachte, dass die Erde eine Kugel ist. Bis zur Eröffnung des Panamakanals im Jahr 1914 war Punta Arenas der wichtigste Hafen im Süden des amerikanischen Kontinents und obligatorische Anlaufstelle für Schiffe jeglicher Art auf ihrem Weg zwischen Atlantik zum Pazifik.

Das Erbe der Schafzüchterbarone
Wenn der Bronze-Magellan mit hochmütigem Blick auf die Stadt zu seinen Füßen blickt, auf das Ensemble aus Platz, Zypressen und Häusern, kann er zufrieden sein. Die Plaza de Armas ist ja auch ein besonderer Ort. Ringsum stehen die prächtigen Paläste der Schafzüchterbarone, die sich einst das Land mit all seinen Schätzen unter den Nagel gerissen haben. Der aus Spanien stammende Kaufmann José Menéndez oder die aus Litauen geflüchteten Geschwister Moritz und Sara Braun hatten mit Geschick und gelegentlich krimineller Energie Estanzien aufgebaut, deren Größe jede Dimension sprengte. Das boomende Schifffahrtsgeschäft erschloss zusätzliche Einnahmequellen.
Frühkapitalismus war die Ideologie dieser durch Heirat verbandelten Familien, die den Aristokraten in Paris, London oder St. Petersburg in Nichts nachstehen wollten. Mit allergrößter Lust stellten sie ihren Reichtum zur Schau -Marmor aus Italien, Möbel aus England und edle Gläser aus Böhmen. Die feine Gesellschaft verlustierte sich bei Banketten und Pferderennen oder lauschte Arien. Das noble Opernhaus, nur ein paar Schritte vom vornehmen Club de la Uníon entfernt, wo Antarktisforscher, Trekker und Kreuzfahrtsofties in plüschigen Sesseln über Gott und die Welt klönen, war 1881 mit Verdis „Aida“ eröffnet worden. Es sah unter anderem die Darbietung der russischen Primaballerina Anna Pawlowa – die schwerreichen Züchter hatten sie für einen Auftritt am Ende der Welt verpflichtet.

Dem Auge fern, dem Herzen ewig nah.
So heißt es auf einem schlichten schwarzen Stein, der inmitten all der überbordenden Pracht auf dem Friedhof von Punta Arenas seltsam deplatziert wirkt. Sind diese Worte das letzte Vermächtnis des Verstorbenen, gar eine melancholische Botschaft an die Hinterbliebenen oder doch nur eine nostalgische Reminiszenz an die unendlich ferne, alte Heimat jenseits des Ozeans? Kein Kranz, nicht einmal eine einzige Rose schmückt die letzte Ruhestätte des Martin Schultz Kabczyk. Nicht mal im Tode waren sie gleich, die einfachen Leute, die im tiefen Süden Chiles Auskommen und Zuflucht vor Armut und Verfolgung in Wales, Deutschland oder auf dem Balkan suchten. Die Oppermanns und Purtzs, die Bergmanns und Vogts konnten sich keines jener haushohen Mausoleen leisten, wie sie zu Dutzenden an den schnurgeraden Alleen stehen. Die Schafbarone dagegen mussten noch in der Stunde ihres Ablebens protzen und ließen sich prächtige Tempel des Todes erbauen.

Gefilde der Pioniere
Wer heute nach rund vierstündigem Flug von Santiago de Chile in Punta Arenas landet, ist meist nur auf der Durchreise, unterwegs gen Süden nach Feuerland, dem Gefilde der Pioniere und Träumer, oder in die Antarktis; nach Westen, wo die gewaltigen Anden in einem Labyrinth aus Tausenden von Inseln zerbröseln oder nach Norden, nach Puerto Natales. Die Hafenstadt erwacht erst dann so richtig zum Leben, wenn die Navimag-Fähre Rucksackreisende ausspuckt.
Es ist nicht so, dass der Ort mit seinen knallig bunten Häuschen keinen Reiz hätte. Und der Seno Última Esperanza, der Fjord der „letzten Hoffnung“, ist keineswegs so trostlos, wie der Namen vermutet lässt; schon gar nicht, wenn sich die verschneiten Bergkronen der Cordillera Riesco in der ruhigen See spiegeln, auf der elegante Schwarzhalsschwäne schaukeln. Doch die wenigsten Touristen kommen wegen der schmucklosen Fisch- und Fleischfabriken, die einst den Reichtum des Städtchens begründeten und nun im unbarmherzigen Klima Patagoniens langsam verrotten. Puerto Natales Triumph ist ein anderer, heißt Torres del Paine und ist Chiles vermutlich schönster Nationalpark.

“Schreie aus Stein”
Das märchenhafte Gebirgsmassiv mit seinen spektakulären Granitsäulen, den weißen Gletscherdächern und den türkisfarbenen Bergseen scheint geradezu aus der endlosen patagonischen Pampa heraus zu wachsen, über die nicht selten Pazifikwinde in Orkanstärke fegen. Die grazilen Guanakos grasen rechts und links der 120 Kilometer langen Schotterpiste; Pumas schleichen sich unbemerkt heran; ein hungriger Kondor zieht einsam seine Runde. „Schreie aus Stein“ nannten die Tehuelche-Indianer die spektakuläre Gebirgslandschaft mit ihren wild gezackten „Cuernos“ und „Torres“, den Hörnern und Türmen, deren Braun und Grau mit dem Grün und Gelb der Täler kontrastiert. Das Werk von Gletschern und Verwitterung ist von so expressiver Schönheit, hat eine so mystische Ausstrahlung, dass es so ziemlich jeden Chile-Prospekt schmückt.

Es ist der ideale Ort, um sich ganz klein gegenüber der Natur zu fühlen. Nandus mit ihrem zerfledderten Federkleid suchen nach Fressbarem. Drüben leuchtet ein milchig grüner See herüber. Darüber thront die berühmte Kulisse aus schnee- und eisbedeckten Spitzen, die je nach Tageszeit in ein feuriges Rot, ein lockendes Orange oder ein melancholisches Grau getaucht sind. Von einer Minute zur anderen ziehen weiß-graue Nebelschwaden auf, umhüllen das steinerne Theater, um es wenig später wieder freizulegen. Ein kräftiger Wind rüttelt an den zarten Pflänzchen, und auf den zahlreichen Seen glitzern weiße Schaumkronen.

Ein Paradies in Gefahr
Doch das Paradies, das seit 1978 unter dem Schutz der Unesco steht, ist in Gefahr. Die vielen Wanderer, der zunehmende Bau von Hotels und Campingplätzen machen dem Nationalpark zu schaffen, vor allem aber die Veränderung des Klimas. „Sehen Sie selbst“, meint die junge Reiseführerin und verweist mit einer ausholenden Armbewegung auf die Abbruchkante des Gletschers, der den Lago Grey speist.
Der breite Moränengürtel und die tiefen Schrammen im sonst glatt geschmirgelten Felsen sind ein untrügliches Zeichen: Der Gletscher, letzter Ausläufer der größten Eismasse südlich des Äquators außerhalb der Antarktis, weicht stetig zurück. Um zwei Kilometer innerhalb weniger Jahre. Noch schaukeln mächtige Eisberge auf dem tiefgrauen Wasser. Irgendwann werden sie an einer flachen Stelle auf Grund laufen und im warmen Licht des chilenischen Sommers langsam schmelzen. Noch können Gäste im nahe gelegenen Hotel „Whisky on the rocks“ genießen können, dessen Eiswürfel deutlich älter sind als das bernsteinfarbene Stöffchen. Doch wie lange noch?
Applaus ist das größte Geschenk für einen Autoren wie mich. Wenn dir dieser Artikel gefallen hat, dann teile ihn doch einfach auf deinen sozialen Netzwerken. Wenn nicht, dann melde dich einfach bei mir und sage mir warum.