Es ist ein besonderer Moment während dieser sieben Tage in Israel, der spontane Gesang einer indischen Pilgergruppe in der Jerusalemer St. Anna-Kirche. In dem schlichten Gotteshaus , nur einen Katzensprung vom imposanten Löwentor entfernt, betete schon die Witwe Balduin I. , der sich zu Beginn des 12. Jahrhunderts acht Jahre lang König von Jerusalem nennen durfte. Es ist eine besondere Reise für mich, eine Zeitreise zu all den biblischen Erinnerungsorten, zu den durchbeteten Orten voll tiefster Frömmigkeit, zu Abertausenden Trittstufen, die – von Fußsohlen, Knien und Lippen wieder und wieder gestreift – schon ganz speckig glänzen.
Die schlichte romanische Kirche entging glücklicherweise der Zerstörung, als Jerusalem in muslimische Hände fiel: Die neuen Herren nutzten das Gotteshaus als Koranschule. Was die Basilika unter all den Moscheen, Synagogen und christlichen Kirchen Jerusalems so einzigartig macht, ist ihre wunderbare Akustik.
Als eine Gruppe indischer Pilger unvermittelt das „Ave Maria“ anstimmt, das gesungene Gebet in seiner zarten Schlichtheit durch den Raum schwebt, fällt es leicht zu glauben: an jene wunderbare Geschichte vom Mann aus Nazareth, der Kranke heilte und Blinde sehend machte und den Grundstein für eine neue Weltreligion legte. Den Spuren Jesu folgen, in Bethlehem, am See Genezareth oder in Jerusalem: Diesem Anliegen folgen jährlich rund 700 000 Pilger, die aus aller Welt nach Israel kommen.
Inhaltsverzeichnis
Tag 1: Am See Genezareth und auf dem Golan
Am See Genezareth, einem der tiefstgelegenen Süßwasserseen der Welt, könnte der Sinnsuchende von heute glatt der Illusion von Authentizität verfallen. Silbrig glänzende Olivenbäume reihen sich am Ufer auf; wohlgenährte Klippdachse sonnen sich auf schwarzem Vulkangestein; in Felsritzen blühen wilde Alpenweilchen und ein Fischer wirft wie seit alters her seine Netze aus. In der sanft geschwungenen Hügellandschaft am Nordufer fällt es leicht sich vorzustellen, wie ein charismatischer Prediger den Mühseligen und Beladenen Hoffnung gab, wie er seine Jünger, einfache Männer aus dem Volk, in alle Welt schickte.
In diesem Landstrich, grün und fruchtbar, soll Jesus Christus unzählige Wunder vollbracht haben. Und an jedes erinnert ein Gotteshaus: die schlicht gehaltene Brotvermehrungskirche bei Tabgha, über die Benediktiner wachen; die winzige Primatskapelle, wo die fischenden Jünger dem Auferstandenen begegneten; der Berg der Seligpreisung, wo der Italiener Antonio Barluzzi, der Grossist katholischen Bauens im Heiligen Land, ein oktogonales Gotteshaus errichtete.

Die Synagoge von Kapernaum
Die sorgsam aufgetürmten Mauern einer alten Synagoge in Kapernaum stammen zwar aus dem vierten Jahrhundert, doch die Ruine beschwört selbst beim größten Zweifler Bilder herauf: So könnte sie ausgesehen haben, jene Synagoge, in der vor mehr als 2000 Jahren Jesus predigte. Nur das Gotteshaus, das über dem angeblichen Haus Petrus errichtet wurde, will nicht so recht ins historische Bild passen. Der Betonklotz erinnert eher an gestrandete Raumschiffe aus dem Film „Krieg der Welten“, denn an ein Fischerboot.

Bunker auf den Golanhöhen
Wenn man nicht wüsste, dass der Boden mit Blut getränkt und erbittert umkämpft ist, der Betrachter würde dem Zauber einer Landschaft verfallen, die dem Bild eines friedlichen Paradieses schon ziemlich nahe kommt. Bei der Fahrt auf die Golanhöhen, die Israel im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberte und längst als Eigentum betrachtet, zeigt sich die ganze Tragweite des Konflikts zwischen verfeindeten Nachbarn.
Zwischen üppigen Mango-, Bananen-und Olivenplantagen, schier endlos scheinenden Rebgärten liegen Relikte der kriegerischen Vergangenheit. Der Blick fällt auf alte Bunker und am Straßenrand verrostende Panzer, auf Schilder, die vor tödlichen Minen warnen, auf Stacheldraht, auf neue jüdische Ortschaften und die Ruinen des 1967 zerstörten syrischen Quneitra, das 20000 Einwohner hatte und jenseits der Grenze neu aufgebaut wurde. Blauhelmsoldaten überwachen die militärische Pufferzone. Am Horizont ist Damaskus zu erahnen, Luftlinie keine 50 Kilometer entfernt, wo ein Diktator Krieg gegen das eigene Volk führt und auf Rache für zwei verlorene Feldzüge sinnt.
Tag 2: Zur Jordanquelle und nach Nazareth
Im oberen Jordantal nimmt jener Fluss seinen Lauf, dessen Wasser Segen und Fluch zugleich ist. Segen, weil er knochentrockenes Land in blühende Oasen verwandelt; Fluch, weil er eine Quelle stetiger Streitigkeiten zwischen den Anrainerstaaten ist und es ohne Einigung über das knappe Gut niemals Frieden im Nahen Osten geben wird. Die Banyas-Quelle am Fuß des 2814 Meter hohen Hermon, wo Israelis im Winter Skifahren, ist der östlichste der vier Zuflüsse des Jordan und historischer Boden obendrein.
In Caesarea Philippi
In den Fels gehauene Nischen, umgestürzte Säulen, Reste von Mauern und Mosaiken künden von einstiger Pracht und planvoller Architektur der Stadt Caesarea Philippi. Hier sollen sich die Legionen Kaiser Tiberius erholt haben, nachdem sie den Jerusalemer Tempel zerstört hatten.
Heute wirkt der Ort, der kunstvoll von schmalen Wasserläufen durchzogen ist, wie ein verwunschener Garten. Seltene Vögel kreisen über den Becken mit klarem, frischem Quellwasser; am Wegesrand liegt eine römische Wassermühle, und am Kiosk decken sich Touristen mit kleinen Fläschchen gefüllt mit Jordanwasser ein. Das Rauschen des Flusses ist Glücksmusik in dieser Ecke der Erde. Wer sieht, wie der Fluss im Frühjahr das Land zum Erblühen bringt, kann verstehen, warum die Israelis sich bis heute schwer tun, die Golanhöhen für die Hoffnung auf Frieden zu tauschen.

Die Verkündigungskirchen von Nazareth
Dabei müsste Israel schon aus Eigeninteresse am Ausgleich mit den Arabern interessiert sein. Nazareth im Herzen Galiläas ist mit seinen 76 000 Einwohnern die größte arabische Stadt des Landes. Die lebhaften Basargassen und die Abgaswolken auf den Straßen mögen nicht ganz den Erwartungen christlicher Pilger entsprechen, die hier jenen Ort suchen, an dem Erzengel Gabriel Maria die Geburt des künftigen Erlösers verkündete.
Doch zum Ausgleich gibt es gleich zwei Verkündigungskirchen: die griechisch-orthodoxe Gabrielskirche mit ihrer prächtigen Ikonostase und das katholische Pendant, eine der größten Kirchen Israels. Der moderne Kirchenbau aus den 70er-Jahren, dessen weithin sichtbare Kuppel eine Lilie symbolisieren soll, integriert sowohl alte Mauerreste aus Kreuzfahrerzeit, als auch die unterirdische Mariengrotte.
So bombastisch das Gotteshaus von außen wirkt, so berührend ist die moderne Kirchenkunst in der Oberkirche und im Hof. Künstler aus der ganzen Welt haben auf unterschiedliche Weise jenen Moment interpretiert, als der Erzengel zu Maria trat. Einige zeigen die Mutter Jesu mit asiatischen, andere mit europäischen oder afrikanischen Gesichtszügen.


Ohne die historische und religiöse Verknüpfung mit der Person Jesu wäre Nazareth wohl ein „viculus“, ein Dörfchen geblieben, wie Kirchenvater Hieronymus schrieb. Um Christi Geburt lebten höchstens 400 bis 500 Menschen an diesem Ort, meist in unterirdischen Höhlen. Doch mit dem aufkeimenden Pilgertourismus änderte sich dies schnell; die Wallfahrt brachte Nazareth Wachstum und Wohlstand.
Der Heilige Willibald, der sich im 8. Jahrhundert auf den Weg ins Heilige Land machte, berichtete, dass die Christen den Muslimen oft „Schutzgeld“ zu zahlen hatten, um ihre Kirchen vor der Zerstörung zu bewahren. Die Vorgängerbauten der Verkündungskirche fielen aber nicht nur religiösen Eiferern zu Opfer. Ebenso oft wurden sie durch Erdbeben zerstört. Schließlich liegt die Landschaft mit den vielen Namen – Israel, Palästina oder Kanaan – genau über zwei tektonischen Erdplatten.
In der Verkündigungskirche
3. Tag: Von der Taufstelle zum Toten Meer
Weiter gen Süden: IsraelsLandschaft wird karger, trockener, wüstenähnlich. Der Jordan, die Lebensader des Mittleren Ostens, ist nur noch ein Schatten seiner selbst: ein tristes, grünliches Rinnsal, nicht mehr als fünf Meter breit, das sich träge dahin schleppt und stellenweise einer stinkenden Kloake gleicht – weil ungeklärte Abwässer viel zu häufig im Fluss landen. Eine solch unappetitliche Brühe möchte man keinem Religionsstifter zumuten. Und gelegentlich nimmt das Wetteifern um die Echtheit biblischer Orte, die uns seit Kindertagen begleiten, reichlich skurrile Züge an. Vor allem, wenn es um die Taufstelle Jesu geht.
Spirituelle Deutungshoheit
Wo wirkte Johannes der Täufer vor gut 2000 Jahren? Auf unserer Seite, sagen die Jordanier, die die Adelung als Weltkulturerbe für sich in Anspruch nehmen können; am anderen Ufer, betonen die Israelis, die Qasr al-Yahud favorisieren. Im Nahen Osten streitet man sich schließlich über alles, auch über die spirituelle Deutungshoheit.
Biblisch betrachtet spricht viel für die jordanische These als Ort des Geschehens: „In Bethanien, auf der anderen Seite des Jordan“, heißt es im Johannesevangelium, und auch die Überreste von Kirchen aus unterschiedlichen Epochen weisen auf frühe Pilgerströme am östlichen Ufer des Jordans hin. Doch weil kein Land auf die prestigeträchtige Pilgerstätten verzichten möchte, gibt es am Jordan eben zwei Taufstellen. Während am Wadi al-Kharrar italienische Pilger ins Wasser steigen, erneuern bei Qasr al-Yahud kanadische Baptisten laut schwatzend und Selfie-schießend ihr Taufgelöbnis.

Das “israelische Lourdes”
Als wären zwei Taufstellen nicht schon genug, gibt es noch eine dritte: Yardenit am See Genezareth, wohin die Pilger nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 ausgewichen sind, als der Zugang zum unteren Jordan gesperrt war. Das Historiker das wenige lauschige Plätzchen für kaum plausibel halten, stört die überwiegend freikirchlichen Christen und Baptisten nicht, die das „israelische Lourdes“ mit jährlich mehr als einer halben Million Besuchern zu einer der meistbesuchten Stätten des Landes machen.
In wallenden weißen Gewändern tauchen sie im Flusslauf unter, Priester segnen, als gäbe es kein Morgen, Gläubige füllen Flaschen und Kanistern mit dem kostbaren Nass für den religiösen Hausgebrauch. Die letzte Gewissheit über den Ort am Jordan, an dem Johannes der Täufer wirkte, kann es ohnehin nicht geben, denn in der Antike war der Fluss im Frühjahr ein reißender Strom, der sich ständig ein neues Bett schuf.

Weil das Wasser des Jordans auf landwirtschaftlichen Feldern landet und nicht mehr im Toten Meer, ist eines der größten Naturdenkmäler auf diesem Planeten in seiner Existenz bedroht. Das Salzmeer, dessen Wasserspiegel 400 Meter unter dem des Mittelmeeres liegt, ringt mit dem Tod.
Jedes Jahr geht der Wasserspiegel um einen weiteren Meter zurück. Glaubt man den Prognosen, wird in 50 Jahren allenfalls ein winziger Resttümpel vorhanden sein. Weil der Salzsee dringend Wasser braucht, haben sich die verfeindeten Brüder Jordanien, Israel und die Palästinenser sogar auf ein gemeinsames Projekt verständigt: Ein 180 Kilometer langer Kanal soll die Badewanne mit ihrem gesunden Reizklima mit Wasser aus dem Roten Meer versorgen.
Schwerelos schweben
Denn Israels Gesundheitstourismus boomt. Der extrem hohe Salzgehalt von über 30 Prozent mildert Hautleiden, die trockene, saubere und pollenfreie Luft, reich an Sauerstoff tut der Lunge gut. Der tiefstgelegene See der Welt ist ein Kurort par excellence, auch wenn er nicht wirklich zum Herumtollen und Schwimmen taugt. Übermütige Sprünge in die Salzplörre sollte man tunlichst vermeiden, die Augen tränen noch Tage später. Dafür kann der Badende schwerelos schweben und Rollen wie ein Wal vollführen. Sich im schwarzen Schlamm zu suhlen, der seidig glänzend durch die Finger quillt, bereitet reinstes Wohlgefühl wie in fernen Kindertagen.
Tag 4 und 5: Jerusalem, die Unvergleichliche
Endlich der Höhepunkt unserer Pilgerreise: Jerusalem. Der Blick aus dem Hotelfenster auf die erwachende Stadt ist atemberaubend. Ein Meer aus Kirchtürmen erhebt sich wie ein Fingerzeig in den Himmel, und über allem thront die goldene Kuppel des Felsendomes, die im Licht der aufgehenden Sonne überirdisch schön leuchtet. Die Unvergleichliche – Stadt Davids, Ort der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, Ausgangspunkt für die Himmelsreise Mohammeds – ist unwiderstehlich und verstörend zugleich. Kein Schmelztiegel, sondern ein erzwungenes Miteinander von Juden, Muslimen und Christen. Und weil jeder seinem Gott gefallen, den anderen womöglich übertrumpfen will, gibt es ein Übermaß an Moscheen, Synagogen und christlichen Kirchen.

Deren berühmteste ist für christliche Pilger zweifelsohne die Grabeskirche, wo schon mal die Fäuste fliegen, weil Kopten, Katholiken und Orthodoxe eifersüchtig über jeden Winkel der Grabstätte Jesu wachen. Denn eigentlich ist diese Gemeinschaft eine streitbare Mönchs-WG, mit Quartieren für Griechisch-Orthodoxe, Franziskaner und Armenisch-Orthodoxe, mit unzähligen Seitenkapellen und Altären, mit Gottesdiensten zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Und weil Wohngemeinschaften selten ohne klare Regeln funktionieren, schon gar nicht, wenn es um die Finanzierung anstehender Aufgaben gibt, wurde in der Grabeskirche alles haarklein geordnet – vom türkischen Sultan Osman III., der des ewigen Streits zwischen den sechs christlichen Konfessionen überdrüssig war und ein Dekret erließ.

Der heiligste Ort der Christenheit
Demzufolge bekam jede Konfession eigene Areale und Gebetszeiten zugewiesen, der „Status quo“ der Kirche durfte fortan nur noch im Einvernehmen aller Glaubensgemeinschaften geändert werden. Was dazu führt, dass selbst eine schmucklose Leiter, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts auf der Balustrade über dem Eingang steht, als „unverrückbar“ gilt. Zur Einschränkung sei allerdings gesagt, dass die Leiter auf den zahllosen Abbildungen und Fotografien der vergangenen 200 Jahre mal mehr, mal weniger Sprossen aufweist – womöglich Beweis dafür, dass das Original still und heimlich ersetzt wurde. Die Schlüsselgewalt zum heiligsten Ort der Christenheit liegt seit dem siebten Jahrhundert angeblich in den Händen zweier alteingesessener muslimischer Familien.
Pilgern im Takt der Nacht
Still und andächtig geht es in der Grabeskirche allenfalls nachts zu, wenn das hölzerne Doppeltor hinter einer Handvoll ausgewählter Christen abgeschlossen wird – ein Brauch, der schon im Mittelalter existierte, nur dass es damals bei Trinkgelagen und Liebesspielen ziemlich ausgelassen zuging, während heute Andachten und Messen den Takt der Nacht vorgeben.
Tagsüber quillt die Grabeskirche über. Die Gläubigsten knien vor dem Balsamstein, auf dem der tote Leib des Heilands gelegen haben soll, und küssen ihn inbrünstig. Die Eiligen begnügen sich mit ein paar Schnappschüssen der vielen Kapellen.
Die Geduldigen, die den Golgatha-Felsen berühren wollen, stehen Schlange. In der riesigen Kirche mit der Rotunde im Zentrum steht man am Ende in einer winzigen Kammer, die nichts Überirdisches an sich hat. Und doch ist die Grabplatte speckig von all den Mündern, die sie geküsst und berührt haben. Nur wenige Minuten hat das kleine Grüppchen Zeit, dann sind die nächsten an der Reihe. Und doch kehrt mancher mit einem seligen Lächeln und Tränen in den Augen zurück.

Jerusalem: Glauben und Ideologie
Alles in dieser Stadt ist historisch kontaminiert, verschweißt mit Glaubensgeschichte und Ideologie. Jerusalem ist nicht mehr und nicht weniger als ein in Stein gegossenes Geschichtsbuch mit römischen Bögen, byzantinischen Kirchen, Kreuzfahrermauern und osmanischen Festungswällen.
Eigentlich müssten die Menschen die gelassen-abgeklärte Haltung jener an den Tag legen, die schon alles gesehen haben. Die miterleben mussten, wie fremde Völker Anspruch erhoben, wie neue Herren kamen und gingen: Kreuzfahrer, muslimische Eroberer, osmanische Herrscher, britische Kolonialherren, jordanische Truppen, jüdische Zionisten, Pilger, Wallfahrer und Touristen.
Doch unbeschwert, gar gleichmütig sind an diesem spirituellen Mittelpunkt für Milliarden nicht einmal die Kinder. Eine unheilvolle Spannung liegt über der Stadt, eine unheilschwangere Feindseligkeit, die sich jederzeit entzünden kann. Manchmal genügt schon der auffallende Habit eines Benediktinermönches, manchmal ein paar freche Wortgefechte unter Jugendlichen, um Streit eskalieren zu lassen. Gute Nachbarschaft sieht anders aus.

Zankapfel Jerusalem
Nirgendwo ist die Feindseligkeit spürbarer als am Tempelberg, für den es nicht mal einen gemeinsamen Namen gibt. Har HaBayit nennen die Juden das Hochplateau in der Altstadt von Jerusalem, wo König Salomon den ersten Tempel errichtete und Herodes den zweiten in ein Weltwunder verwandelt haben soll. Vom edlen Heiligtum al-haram asch-scharif sprechen die Moslems, wo Mohammed zu seiner Himmelsreise aufgebrochen sein soll. Es ist ein ewiger Kreislauf der Konfrontation, am heiligsten aller jüdischen Orte: Ultranationalisten schwadronieren über einen neuen Tempel auf dem Berg Moriah, aus dessen roter Erde Gott den ersten Menschen geformt haben soll.

Scharfmacher auf palästinensischer Seite behaupten, dass der Tempel der Juden nur Legende sei. So gehen politische und religiöse Konflikte Hand in Hand an einem Ort, wo der Wunsch, dem Haus Gottes nahe zu sein, die Menschen nur vordergründig eint. Auf dem Platz vor der Klagemauer, dem kleinen Rest vom Protzbau des Herodes, rezitieren schwarz gekleidete Orthodoxe Verse aus der Thora und wippen dabei so rhythmisch vor und zurück, dass die Schläfenlocken wippen.
Auf dem Plateau streben Muslime mit dem Gebetsteppich unter dem Arm zu Al -Aqsa-Moschee. Dazwischen: junge israelische Soldaten und Kräfte der Waqf, der religiösen Stiftung der Muslime in Jerusalem. Und die hält das Areal unter Verschluss, verhindert jegliche archäologische Grabung, die die Existenz des Tempels untermauern könnte.

Ein Holzkreuz für fromme Pilger
Wer die knapp ein Quadratkilometer große Altstadt durch das Damaskustor betritt, das vielleicht schönste der Stadtmauer, landet im Gewusel des arabischen Viertels. Orientalische Exotik, wohin das Augen blickt. Treppen aus goldfarbenem Sandstein führen auf und ab, Häuser schmiegen sich dicht aneinander.
An einem Kebab-Stand duftet es verlockend nach gebrutzeltem Fleisch; ein paar Meter weiter stopft ein Verkäufer knusprig-frittierte Falafel-Bällchen in frisch gebackenes Pita-Brot. Gleich gegenüber decken sich Touristen mit honig-süßem Mandelgebäck ein. An einem Stand voll religiösem Tand gibt es Rosenkränze, Marienstatuen und Postkarten mit „Jerusalem im Schnee“-Motiv.
Vitali, der orthodoxe Christ aus der Ukraine, hat für all das keine Augen. Er will Jesus nahe sein, trägt wie der Erlöser ein Holzkreuz vom Löwentor bis zur Grabeskirche: 30 Kilo schwer und gemietet in einem kleinen Geschäft nahe der schlichten Geißelungskapelle.


Tag 6: Bei den Palästinensern in Bethlehem
Auf den Hirtenfeldern von Bethlehem, wo ein Engel den Viehhütern die Botschaft von der Geburt Jesu überbracht haben soll, wird einem die Unlösbarkeit des schwelenden Konflikts im Heiligen Land bewusst: die Geburtsstadt Jesu im Zangengriff von Mauer, Stacheldraht und Überwachungstürmen. Nur zehn Kilometer trennen Jerusalem und das palästinensische Bethlehem, und doch liegen Welten zwischen den verfeindeten Brüdern. Für die meisten Israelis ist das steinerne Ungetüm, an einigen Stellen doppelt so hoch wie die Berliner Mauer, nur eine Sperranlage gegen Selbstmordattentäter; die Palästinenser brandmarken es als „Apartheidsmauer“.
Die knorrigen Olivenbäume, die uralten Pinien, die steinigen Hänge können nicht übertünchen, dass das Bollwerk Familien von ihren Verwandten trennt, Felder und Dörfer zerschneidet und manches Haus in einen Käfig verwandelt.
Denn anders als die Berliner Mauer, die peinlich genau auf DDR-Territorium errichtet wurde, ragt die israelische Mauer weit in palästinensisches Gebiet hinein und folgt nicht dem Verlauf der Waffenstillstandslinie. Sie schlägt regelrecht Haken, um völkerrechtlich umstrittene Siedlungen wie Har Choma oder Gilo zu umschließen. Die Häuser, verkleidet mit dem teuren Jerusalemstein, wirken keineswegs wie die Hochburgen ultraorthodoxer Juden, doch was bleibt künftig an Land für die Palästinenser?

In diesem Landstrich wird jede Entscheidung zum Politikum. Als die Unesco die Geburtskirche von Bethlehem, eines der ältesten Gotteshäuser der Welt, zum Weltkulturerbe erklärte, hagelte es Kritik von israelischer Seite.
Dabei ist ziemlich unbestritten, dass der Zahn der Zeit erbarmungslos an diesem kostbaren Konglomerat der Epochen und Stile nagt, das sich hinter der nur 1,20 Meter hohen Eingangspforte verbirgt. Die menschengroßen Engel, die Besuchern mit ausgestreckten Händen den Weg zur Geburtsgrotte weisen, waren bis vor kurzem nur noch Schattengestalten, bedeckt von Kerzenruß und dem Staub aus acht Jahrhunderten. Die uralten Dachbalken waren morsch, die Bleidecke drohte einzustürzen. Brokat und Seide, Bordüren, Litzen und Schabracken waren mal mehr, mal weniger zerschlissen.

Pilgerziel als Einnahmequelle
Dabei ist das Gotteshaus unter seinem Tarnmantel aus Gläubigkeitskitsch, dem heillosen Gewirr aus Um- und Anbauten ein unbezahlbarer Schatz: Von der ersten Basilika, die Kaiser Konstantin um 325 nach Christus errichtet ließ, blieb zwar kaum etwas übrig, doch der justinianische Neubau überlebte den Angriff der Perser im Jahr 614 – offenbar sahen sie in den „Heiligen Drei Königen“ auf der Außenfassade persische Landsleute. Und die Geburtskirche entging wie durch ein Wunder auch der Zerstörungswut Hakim ibn Amr-illach unmittelbar nach der ersten Jahrtausendwende. Die neuen Herren hatten schnell gelernt, dass intakte Pilgerziele eine nie versiegende Einnahmequelle darstellen.
Tag 7: Tel Aviv, die Sorglose
Sabbat in Jerusalem. Die Stadt hält den Atem an, verordnet sich eine Zwangspause. Keine Kinos, keine Supermärkte, nicht mal Bahnen und Busse. Wer unter den strenggläubigen Juden etwas auf sich hält, holt an diesem Festtag den „Schtreiml“ hervor, die hohe Pelzmütze, die die Vorfahren aus Osteuropa mitbrachten.
Mit flottem Schritt eilen sie zur Klagemauer, während säkulare Geister zum Wochenende nur einen Weg kennen: raus aus dieser Stadt, wo es kein alltägliches Leben zu geben scheint und man auf kurz oder lang mit dem alles überlagernden Konflikt konfrontiert wird. So sehr an der Oberfläche Ruhe herrscht, so gibt es doch kein wirkliches Entkommen.

Der “Hügel des Frühlings”
70 Kilometer nach Westen und 800 Meter tiefer ist nichts mehr religiös aufgeladen. Für einen „Ultra-Orthodoxen“ ist Tel Aviv, das 1909 von ein paar Dutzend Familien gegründet wurde, wohl das reinste Sündenbabel. Junge Frauen stolzieren in knappen Shorts und freizügigen Oberteilen an der Uferpromenade entlang, verliebte Pärchen sitzen knutschend auf einer Bank, und am Carmel-Markt mischen sich fremdartige Sprachfetzen zu einer nicht enden wollenden Symphonie.
Tel Aviv, das dank seiner 4000 Gebäude im Bauhausstil zum Weltkulturerbe zählt, ist weder schön noch anmutig ; da müsste man schon die paar Kilometer nach Jaffa zurücklegen. Doch der „Hügel des Frühlings“, wo Ben Gurion 1948 den Staat Israel proklamierte, strahlt Sorglosigkeit aus.
Als am Nachmittag der Flieger Richtung Deutschland abhebt, nimmt er meine zwiespältigen Gefühle mit. Die Pilgerreise ins Heilige Land hat mehr Fragen aufgeworfen, denn beantwortet, hat mich vielerorts traurig, häufig sprachlos und erschüttert zurückgelassen. Wo für Gott, vielleicht mit Gott gestritten wird, wo es vor allem um die Frage geht, wer den Weltenschöpfer besser verstanden hat, wird die Hoffnung auf Aussöhnung wohl noch für lange Zeit ein frommer Wunsch bleiben.

Und wenn euch dieser Bericht gefallen hat, dann teilt ihn doch auf den sozialen Netzwerken. Und natürlich sind auf dieser Seite Kommentare willkommen.
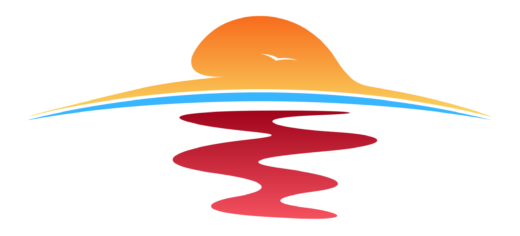





[…] Bruder auf Achse nimmt uns Roswitha mit zu Sieben Tagen Pilgern in […]
[…] bruder-auf-achse.de […]