Mythos Transatlantik: Mit jeder Seemeile rückt das Ziel der Transatlantiküberquerung, Bayonne unweit von New York näher. Doch zunächst legt die “Mein Schiff 6” in Prince Edward Island und Nova Scotia an, Provinzen, die ein reiches europäisches Erbe haben. Und natürlich erkläre ich im letzten Teil meines Schiffs-Tagebuches, warum für uns in Halifax die Reise zu Ende war. Doch zunächst werfen wir Anker in Charlottetown.
Inhaltsverzeichnis
In Charlottetown
Goliath besucht David, und das ohne jede kriegerischen Absichten. Als die „Mein Schiff 6“ am frühen Morgen in Charlottetown, der Hauptstadt von Prince Edward Island einläuft, muss man Sorge haben, dass der Ort wegen Überfüllung geschlossen wird. 35 000 Einwohner zählt die kleinste Provinzhauptstadt Kanadas; mit dem Schiff von TUI Cruises kommen weitere 2700 für einen Tag hinzu. Für die Bewohner von Charlottetown, die ihren Namen einer preußischen Prinzessin aus dem Hause Mecklenburg-Strelitz verdanken, ist der große Pott ein Grund zu feiern, sind sie es doch gewohnt, dass ihre Heimat angesichts all der Highlights im zweitgrößten Land der Erde gerne übersehen wird.

Ein kanadischer Kartenverlag brachte es sogar einmal fertig, die gut 5.500 Quadratkilometer große, halbmondförmige Insel im Sankt-Lorenzgolf glatt zu unterschlagen. Und selbst der Name, Prince Edward Island ist den meisten Landsleuten viel zu lang, weshalb im Hoheitsgebiet der Ahornflagge fast nur von PEI gesprochen wird.
Interessant wie Dänemark?
Reiseführer können ganz schön grausam sein. PEI – für kanadische Verhältnisse dicht besiedelt – sei in etwa so interessant wie Dänemark, nur dass es keine pulsierende Metropole wie Kopenhagen zu bieten habe. Den Lästermäulern im eigenen Staat fallen in erster Linie Holsteiner Kühe und Kartoffeläcker zu der nur zweihundert Kilometer langen und bis zu 60 Kilometer breiten Insel ein. Beides hat seine Berechtigung, wie sich bei der Fahrt über die Insel zeigt. Auf grünen Weiden grasen schwarz-weiß-gescheckte Rindviecher und zottelige Galloway. Auf endlosen Feldern wachsen Mais, Weizen und immer wieder Kartoffeln.

Kanadas Kartoffelprovinz
Säuberlich in Reih und Glied gepflanzt stehen die Pflanzen Spalier für blaue, gelbe und rote Farmhäuser, die so hübsch anzusehen sind, als hätte sie der Fotograf gerade fürs nächste Landlust-Magazin dekoriert. Den wenig schmeichelhaften Titel „Kartoffelprovinz“ tragen die 174.000 Insulaner mit breiter Brust. Immerhin wird auf Prince Edward Island rund ein Drittel der gesamten Kartoffelernte Kanadas eingebracht, und die Knolle wird zu allerlei Fertigprodukten weiterverarbeitet.
Ich war ganz schön überrascht, als ich bei meinem Studienjahr in Deutschland McCaine-Pommes Frites im Supermarkt entdeckt habe. Die werden nämlich aus Kartoffeln aus PEI gefertigt
erzählt Maude in akzentfreiem Deutsch. Letzteres ist dem Aufenthalt in Oldenburg zu verdanken.

Lieblich wie ein englischer Landschaftsgarten
So unbekannt die Insel bei Europäern, selbst bei Kanadiern auch sein mag: PEI ist ein rechtes Schmuckstück, lieblich wie ein englischer Landschaftsgarten, aufgeräumt wie die schmucken Orte Neuenglands. Die Blumenbeete vor der Häusern werden liebevoll gepflegt, als gelte es, den schönsten Garten der gesamten Insel zu küren. Die Rasenflächen sind so akkurat geschnitten wie das halbe Dutzend Golfplätze. Gehwege und Straßen sind so sauber, dass selbst Singapurs Gesetzeshüter nichts zu meckern hätten.
Im Süden prägen rostrote Sandsteinklippen das Bild, im Norden liegen prächtige Sandstrände wie Cavendish oder Brackley Beach, versteckt hinter Lorbeerbüschen, Buschrosen und Hortensien. Weil sich das Meer im Sommer schnell auf über 20 Grad erwärmt, bringt selbst der Sprung ins kühle Nass keinen Kälteschock. Was sich rumgesprochen hat: Die Flüge von Boston, New York, Toronto oder Montreal sind meist gut gebucht.

Schon die Mi´kmaq-Indianer schätzten das Eiland als Jagdrevier und verliehen ihm das Prädikat „Wiege auf den Wellen“. Später kamen Iren, Schotten und französisch sprechende Acadians aus Nova Scotia, die partout keine Lust hatten, einem neuen Herren zu dienen: den Engländern. Vor gut 150 Jahren schrieb dieses Multi-Kulti sogar Landesgeschichte. 1864 trafen sich in die Vertreter verschiedener britischer Provinzen Nordamerikas in Charlottetown , um über eine politische Union zu beraten. Heraus kam dabei der Staat Kanada, dem Prince Edward Island zunächst mal die kalte Schulter zeigte.

So klein die Insel auch ist: Vergangenes Jahr kamen über eine Million Touristen. Sie schlendern durch die Straßen von Charlottetown mit seinen hübschen historischen Häusern aus dem Farbkasten, finden sich im Dorf New Glasgow zu einem Lobster Supper ein, mit denen Pastoren einst die Arbeit der Kirchengemeinden finanzierten, oder radeln durch den Prince Edward Island Nationalpark. Dort liegt auch der größte Trumpf der kanadischen Miniprovinz – ein schmuckes, weißes Farmhaus mit grünen Holzläden.

Das Bilderbuchanwesen ist die reinste Pilgerstätte, spielt sich hier doch die Geschichte über ein armes rothaariges Waisenmädchen mit ziemlich großem Mundwerk und dem Herzen auf dem rechten Fleck ab: das Buch „Anne of Green Gables“ der Schriftstellerin Lucy Maud Montgomery wurde in unzählige Sprachen übersetzt und zählt in Japan gar zur Pflichtlektüre. Was erklärt, warum ganze Horden japanischer Touristen, denen zu Kanada sonst nur das Dreigestirn Banff, Niagara und Torontos CNN-Tower einfällt, mit Selfiestick durch das pittoreske Anwesen schlendern. Sie lassen sich mit rotbezopften Anne-Darstellerinnen ablichten und geraten angesichts des Schlafgemachs mit Blümchentapete und Quiltdecke in völlige Verzückung.

Wem das nicht reicht, der kann sich im unvermeidlichen Souvenirshop mit allerlei Tand zur Protagonistin eindecken: Anne als Porzellanpüppchen, als Telleruntersetzer, als Schlüsselanhänger, selbst als Motiv für den Topflappen – der Rotschopf speist eine ganze Industrie, steht sogar im Mittepunkt eines Musicals, das seit Jahrzehnten regelmäßig in Charlottetown gezeigt wird.

Anne of Green Gables als Werbeträger
Prince Edward Island sei ein ruhiges, grünes Paradies, das auf den Wogen des Meeres treibe, schrieb die Autorin Montgomery über ihre Heimat. Das Farmhaus mit den grünen Läden kannte sie von unzähligen Besuchen bei ihren Cousinen, und noch immer existiert jener verwunschene Weg durch den Wald, den Lucy Maud benutzte.
Wer noch nie was von der rothaarigen Göre mit den Sommersprossen gehört hat, deren Lebenslauf acht Bände füllt, wird der irrationalen Begeisterung etwas ratlos gegenüberstehen. Doch verwundern muss es nicht, dass die Helden meiner Kindheit – Pippi, Madita oder Ronja Räubertochter – Seelenverwandte von Anne of Green Gables zu sein scheinen. Das kanadische Kinderbuch zählte nämlich zur Lieblingslektüre von Astrid Lindgren; die Ähnlichkeiten zwischen ihren Buchfiguren und der kanadischen Vorlage sind nicht zu übersehen.
Das Highlight des Tages: Am späten Nachmittag gönne ich mir einen Abstecher zu Cows, die angeblich die beste Eiscreme der Welt verkaufen. Bei einem Wettbewerb landete man noch vor der italienischen Konkurrenz. Die Sorten machen schon namentlich etwas her: Cookie Moonster, Chip Chip Hooray oder Wowie Cowie heißen die himmlischen Kreationen, für die man gerne ein längeres Anstehen in Kauf nimmt.

Weiter nach Nova Scotia
Sydney ist mit rund 30.000 Einwohnern die größte Stadt Nova Scotias. Deutschen Medien ist sie nur deshalb bekannt, weil immer mal wieder Flugpassagiere hier stranden, die eigentlich nach Down Under wollten. Wie groß muss die Enttäuschung sein: Statt des weltberühmten Opernhauses gibt es nur eine Fiddel, immerhin die größte der Welt mit rund 18 Metern Höhe.
Das Streichinstrument, aus Stahl und nicht etwa aus Holz, ist so ziemlich die einzige Sehenswürdigkeit dieser Stadt, die aus einem riesigen Hafen, einer gesichtslosen Innenstadt und einigen schönen Parks besteht. Für Kreuzfahrtschiffe wie die „Mein Schiff 6“ ist der geschützte Hafen allerdings ein wahres Geschenk. Segelschiffe bunkern hier Proviant und Treibstoff, und in North Sydney auf der anderen Seite des Meeresarmes legt die Fähre nach Neufundland ab, die Reisende mit und ohne Auto in sechs Stunden nach Port-aux-Basques bringt.

Im Hafenterminal das gewohnte Bild: Souvenirshops, eine Touristeninformation, ein WLAN-Hotspot und ein Radvermieter, der an diesem Tag gute Geschäfte machen wird. Denn Sydney – das wird schnell klar – ist kein Schmuckstück wie St. John’s.
Zwar wurde eine hübsche Uferpromenade angelegt, wo ein nicht minder schmuckes Denkmal die heroische Arbeit der Kabeljaufischer verklärt; doch dahinter herrscht Tristesse. Die Esplanade Street, die parallel zum Boardwalk verläuft, ist ein betriebsamer Ort mit Geschäften, Restaurants und einigen Hotels. Doch die hübschen historischen Häuser, an die wir uns in dieser Ecke Kanadas gewöhnt haben, sind Mangelware.
Immerhin hat Charlotte Street, ein Block weiter, einige hübsche Backsteinhäuser zu bieten – und einen Tim Hortons. Ein Abstecher zur auf Kaffee und Donuts spezialisierten Kette gehört für etliche Kanadier zum täglichen Pflichtprogramm. Sie wurde nämlich von der Eishockeyikone Tim Horton gegründet.

Wir mieten Räder, radeln zur Mündung des Sydney River und zum Open Hearth Park, der seine Existenz dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt verdankt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die bis dahin unbedeutende Provinzstadt zur Stahlhauptstadt Ostkanadas aufgestiegen, mit Stahlwerken und Koksöfen, wo Tausende Arbeit fanden. Heute erinnern nur noch einige wenige Industrie-Relikte an jene Hoch-Zeit.

In der Nachbarschaft von Cape Breton
So unscheinbar die kanadische Kleinstadt mit dem vielversprechenden Namen auch ist: Jedes Jahr legen rund 60 Kreuzfahrtriesen hier an. Das liegt nicht an Sydneys Liebreiz . Die einstige Stahlarbeiterstadt hat zwei entscheidende Vorteile zu bieten – ihren geschützter Hafen und die Lage zu Cape Breton, das nur durch die rund 770 Meter breite Straße von Canso vom übrigen Nova Scotia getrennt ist.
Zum malerischen Bras d‘Or Lake, der mit seinen einsamen Inseln, den stillen Buchten und den schneeweißen Leuchttürmen eher wie ein Meer, denn wie ein See wirkt, sind es nur wenige Kilometer. Das Highland Village Museum ist ebenfalls bequem per Tagesausflug zu erreichen und so liebevoll gestaltet, dass man sich nur schwer von den kochenden, backenden und Wolle spinnenden Ladys in Originalkleidung aus der jeweiligen Epoche trennen kann.
Für die meisten Besucher ist Sydney Ausgangspunkt für Fahrten auf dem Cabot Trail, entweder mit dem Auto oder per Rad – wenn man denn genügend Kondition für steile Anstiege und genügend Mumm für halsbrecherische Abfahrten hat. Von genügend Zeit für die insgesamt 300 Kilometer lange Ringstraße ganz zu schweigen.

Der Cabot Trai: die schönste Küstenstraße Nordamerikas
Die Route, die vielen als schönste Küstenstraße Nordamerikas gilt, wartet tatsächlich mit einem Panorama zum Niederknien auf. In gefühlten 1.000 Kurven windet sie sich durch das Hochland der Cape Breton-Insel, verläuft mal hoch über dem glitzernden Meer, mal mitten durch verträumte Fischerdörfer.
Wer mit dem Auto unterwegs ist, ist ständig versucht anzuhalten – angesichts des grandiosen Landschaftskinos; eine raue Felsküste, gegen die der Atlantik donnert; einsame Buchten, in denen sich Wale tummeln; verwunschene Wälder, die sich wie dunkelgrüner Samt an die Hänge schmiegen; schneeweiße Leuchttürme, die auf glattgeschmirgelten Felsen thronen; Weißkopfseeadler, die majestätisch in der Meeresbrise segeln.

So atemberaubend der Cabot Trail auch sein mag: als Tagesausflug eignet er sich meines Erachtens definitiv nicht. PS-Fanatikern würde es wohl gelingen, die 300 Kilometer in sechs bis acht Stunden unter die Räder zu nehmen, doch bliebe dann noch Zeit für Entdeckungen? Für das zwei Dutzend Wanderwege, die sich zu Wasserfällen und Aussichtskanzeln schlängeln? Für pittoreske Fischerdörfer wie Neil‘s Harbour oder für einen Abstecher zu Rusty Anchor in Pleasant Bay, wo es die besten Muscheln und Schalentiere ganz Neuschottlands gibt?

Uns fällt der Verzicht auf die berühmte Küstenstraße leicht- schließlich werden wir in Halifax von Bord gehen und Cape Breton mit dem Mietwagen erkunden, mit viel Zeit für die Verlockungen am Rande und ohne jeglichen Stress. Weil uns auch die Feste Louisbourg nicht wirklich reizt, die originalgetreu wiederaufgebaut wurde und wo Laienschauspieler in die Rollen von Soldaten, Generälen und anderen Gestalten des 18. Jahrhunderts schlüpfen, schwingen wir uns in den Fahrradsattel und machen Sydney unsicher.
Das Highlight des Tages: Ein paar neue Turnschuhe gefällig? Keine mit Streifen, sondern mit hübschem Hummermuster. Dieses ziemlich auffällige Exemplar habe ich in einem Geschäft in Sydney entdeckt. Nur hatten sie meine Größe nicht vorrätig.

Lebewohl von der “Mein Schiff 6”
In Halifax heißt es dann Abschied nehmen, von der „Mein Schiff 6“. Natürlich wären wir gerne mit nach New York geschippert, um durch die Hochhausschluchten Manhattans zu spazieren. Mit Begeisterung hätten wir uns in die Museen gestürzt, die Kreditkarte beim Outlet-Shopping glühen lassen und in den plüschigen Sesseln eines der unzähligen Broadway-Theater Platz genommen. Die vier Nächte in einem nagelneuen Hotel am Times Square waren sogar schon gebucht, ebenso wie die Tour durch Harlem auf den Spuren des Jazz. Allerdings hatten wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht, der in diesem Fall amerikanisches Heimatschutzministerium hieß.
Ärger wegen Iranreise: Die USA verschmähen uns
Zum Verhängnis wurde uns: eine Studienreise in den Iran vor einigen Jahren. Angesichts der Tatsache, dass auch schon frühere Präsidenten von der „Achse des Bösen“ gesprochen hatten, hatten wir uns eigens neue Pässe besorgt, ohne störende Stempel des geschmähten Staates.
Wir fühlten uns auf der sicheren Seite, zumal wir in jüngerer Vergangenheit mehrfach in den USA waren und die Esta stets anstandslos erteilt worden war. Mit einer Verschärfung des Fragenkatalogs hatten wir allerdings nicht gerechnet. Waren Sie in den vergangenen paar Jahren im Iran oder Somalia, wollte der Große Bruder wissen – und weil wir nicht lügen wollten – zumal Abhören unter Freunden bekanntlich doch geht -, kreuzten wir pflichtschuldig Ja an. Worauf die Esta ohne Angaben von Gründen abgelehnt wurde.

Wir hätten ein Touristenvisum beantragen können. Stolze 160 Euro hätte dies gekostet. Zusätzlich hätten wir einen Nachmittag opfern müssen, fürs Ausfüllen eines weiteren Fragenkatalogs im Internet. Schon die exakte Auflistung aller USA-Reisen in den vergangenen Jahren wäre nur mithilfe der abgelaufenen Pässe möglich gewesen. Doch das vorgeschriebene Gespräch in der amerikanischen Botschaft, nebst etlicher Bescheinigungen zu meiner Person, brachte das Fass dann zu Überlaufen.
Es stört mich, dass ich als simpler Tourist in die Ecke von Terroristen gestellt werde. Es ist auch wenig einleuchtend, warum der Iran mit seinen unbestreitbaren kulturellen Schätzen als No-go-Area betrachtet wird, während Saudi-Arabien über jeden Verdacht erhaben zu sein scheint. Letztendlich war es dieses aufgeblähte Bürokratiemonster, das uns jede Lust auf die USA nahm. Ich will nicht in ein Land reisen, das mir unlautere Absichten unterstellt, das mit zweierlei Maß misst und von dessen „Gnade“ wir letztendlich abhängig gewesen wären. Denn selbst wenn ich alle Auflagen erfüllt hätte, mich beim persönlichen Gespräch als wahrer Demokrat entpuppt und dank behördlicher Bescheinigungen nachgewiesen hätte, dass ich bestens in Deutschland verankert bin – es wäre letztlich ein Vabanquespiel geblieben.

Dass es auch anders gehen kann, haben wir in Kanada erfahren. Ein kurzes Prüfen der Pässe, ein freundliches Nicken der Herrschaften im Cruiseterminal in Halifax – schon waren die Einreiseformalitäten erledigt. Im Nachhinein bin ich sogar froh, dass uns das Heimatschutzministerium die Entscheidung abgenommen hat. Denn vier Tage New York hätten nicht schöner sein können als vier Tage Cape Breton mit dem atemberaubenden Cabot Trail.
So, das war es nun, das Schiffstagebuch über die Transatlantiküberquerung mit der “Mein Schiff 6”. Wenn euch das Lesen Spaß gemacht hat, freue ich mich über Kommentare. Wenn nicht: Vergesst das Geschriebene einfach. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust bekommen, den Atlantik per Schiff, statt mit dem Flugzeug zu überqueren. Ich kann es nur empfehlen. Und weil bewegte Bilder mehr aussagen, noch ein kurzer Film von der Reise mit der “Mein Schiff 6”.
Für alle die, die den ersten Teil der Transatlantik-Trilogie verpasst haben, hier geht es zum Bericht. Und hier zum zweiten Teil. Und wenn euch die Story gefallen hat, teilt sie doch einfach auf Pinterest. Und natürlich freue ich mich riesig über eure Kommentare.
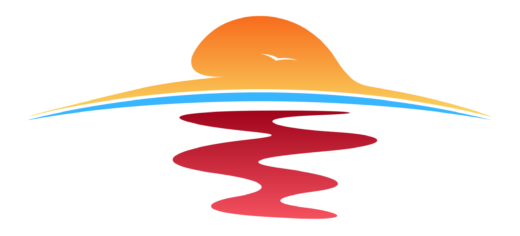




[…] uns die Reise in Halifax zu Ende war, könnt ihr im nächsten und letzten Teil des Berichtes lesen. Hier geht es zum […]
Toller Reisebericht! Und es ist doch immer wieder wirklich schön, auch Mal Orte zu entdecken, die man sonst vermutlich nie angesteuert hätte.
Aber das mit der Einreiseverweigerung wegen des Aufenthalts im Iran geht ja echt Mal gar nicht. Die Amerikaner sind neuerdings in manchen Bereichen echt übergeschnappt. Toll aber, dass ihr das Beste draus gemacht habt und am Ende eben wo anders einen schönen Aufenthalt hattet.
Das war auch unser Grund, warum wir diese Reise gemacht haben. Vor allem Neufundland hat uns total begeistert.
Ich bedanke mich für den schönen Reisebericht, ich habe jede Zeile genossen und konnte mich nochmal zurückbeamen….